Schröder Marine Systems, kurz SMS, wächst aus der Maschinenbauanstalt Schröder & Sohn hervor, die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Südhafen Seestadt dampfbetriebene Hebewerke und Hafenwinden baute. Der erste große Auftrag – ein Paar Kettenwinden für die Alte Hafenmole – gilt bis heute als Beginn der Firmengeschichte; eine der Winden steht restauriert in der Eingangshalle von Tor Süd neben einer Messlatte mit den Teichpegelständen vergangener Hochwässer. Aus der Werkstatt am Kai wurden in den 1890er-Jahren Backsteinhallen, in denen Kettenzüge, Zahnkränze und später die ersten dieselgetriebenen Winden entstanden. Schröder baute die ersten modernen Kräne der Stadt, in den 1950er-Jahren stellte man auf mittlere Viertaktmotoren und geteilte Getriebegehäuse um, und seit den 1990er-Jahren firmiert das Unternehmen als Schröder Marine Systems mit zwei Standbeinen: Antriebe für Binnen- und Küstenschiffe sowie Hafenumschlagtechnik. Heute arbeiten in Seestadt rund 1.200 Menschen für SMS, dazu kommen Servicecrews an Außenstandorten in Bierona, Zentro und an Häfen am Mare Internum sowie der Sturmsee.
Der Hauptsitz liegt im Hafenviertel zwischen den Kaigleisen und der Promenade. Die langen roten Hallen tragen noch genietete Binder; dahinter stehen neue Montageboxen mit Brückenkranen, die über drei parallele Linien führen. In Linie A werden mittlere Schiffsmotoren als Generatoraggregate aufgebaut, Linie B ist für Hybridantriebe mit Batterie- und Umrichterpaketen reserviert, in Linie C entstehen die Oberwagen der Hafenkräne. Ein eigener Prüfstandshangar steht quer zu den Linien: Hier laufen Motoren auf Wasserbremsen ein, und ein Kranstubben hängt an einer Testachse, deren Drehmomentverlauf man auf einem Glassteg von oben betrachtet. Wenn in der Dämmerung die Lüfter anlaufen, legt sich ein tiefer Ton über den Kai; die Anwohner kennen ihn, seit es die Hallen gibt, und stellen die Fenster nur für die halbe Stunde der Lastwechsel zu. In Kranblick 3 betreibt SMS gemeinsam mit der Universität Seestadt ein Technikum mit Schnittmodellen von Motoren, Hydrauliktafeln, einem Kran-Simulator und einer „gläsernen“ Steuerkabine, in der Auszubildende Fehlerbilder in Elektrik und Sensorik suchen. Ein zweites, kleineres Werkstattband nutzt SMS im Nordpark: Dort sitzen Software, Fernwartung und Datenanalyse, ein Raum mit schallisolierten Racks, in dem Live-Daten aus Hafenanlagen zusammenlaufen.
Die Produktpalette wirkt aus der Nähe wie ein Baukasten mit wiederkehrenden Teilungen. Bei den Antrieben reichen die Reihen von kompakten E-Pods für Arbeitsboote bis zu mittleren Verbrennungsmotoren für Fähren, Schlepper und Binnenschiffe. Typisch ist der modulare Aufbau: Basismotor, Generator oder Getriebe, Leistungselektronik in seewasserbeständigen Schaltschränken, vollständige Kühlkreise mit Schnellkupplungen. Beliebt ist in der Region das Hybridpaket „H-45“, das einen 8-Zylinder-Grundmotor mit einem permanentmagneterregten E-Maschinensatz kombiniert; im Hafen läuft damit die Manövrierfahrt elektrisch, auf Strecke schaltet sich der Verbrenner dazu, der seit einigen Jahren auf HVO und Diesel mit Partikelfilter ausgelegt ist. Für Forschung und Lehre stehen kleinere Einheiten bereit: Die Arbeitsboote auf dem Großen Teich fahren mit seitlich montierten Querstrahlaggregaten vom Typ TQ-40 und einer unter Deck installierten Akkukiste, die über Nacht an der Mole geladen wird; Serviceprotokolle davon hängt SMS im Technikum aus, damit Studierende sie lesen, anmerken und in ihr Praktikum mitnehmen können.

Auf der Kranseite fertigt SMS Schienen- und Mobilkräne mit Traglasten für Container und Stückgut. Die K-Reihe beginnt bei kompakten Mobilgeräten mit Teleskopausleger, die in den kleineren Häfen der Region auf engem Raum arbeiten, und reicht bis zu portalseitigen Riesen, deren Oberwagen in Seestadt vormontiert und in Teilen auf Binnenschiffen weitertransportiert werden. Die Auslegergelenke bekommen ihr Fett aus zentralen Blockpumpen, die Leitungen trägt ein farbiger Markierungssatz, der in jeder Halle gleich ist; wer einmal gelernt hat, Gelb für Hub, Weiß für Katzfahrt und Schwarz für Schwenk zu lesen, findet sich in jedem Kabinenschrank zurecht.
Zum Alltag gehört eine robuste Lieferkette, die nah an der Stadt bleibt. Gussteile kommen aus zwei Gießereien im Umland (Unterstrand und Teichmünde), Bleche werden in einer Lohnschneiderei an der Zentochaussee auf Maß gebracht, Kabelsätze fertigt ein Betrieb aus dem Nordviertel. Steuerungs- und Visualisierungssoftware entstehen im Nordpark; dort sitzt ein kleines Team, das die PortSuite betreut – eine Oberfläche, auf der Kranführer Lasten, Winddaten und Sperrbereiche auf einen Blick sieht. In der Werkhalle stehen Wechselrahmen, auf die Endkunden ihre bevorzugten Bedienpulte setzen lassen; ein Fährbetrieb aus dem Blumenland bestand auf haptischen Schaltern und großen Rundinstrumenten, ein Hafen im Osten wollte Touchpaneele mit flachen Profilen, weil Handschuhe dort selten getragen werden. Für Seestadt baut SMS die Schnittstellen so, dass Ersatzteile ohne lange Wartezeiten beschafft werden können; im Lager am Kai liegen Kisten mit standardisierten Dichtungen, Kugellagern und Sensorleisten, deren Etiketten seit Jahren das gleiche Nummernsystem tragen. In einer Ecke des Lagers stehen drei unscheinbare Kisten mit Messingbuchstaben – sie stammen von den alten Dampfwinden und werden gelegentlich an der Winde in der Halle zu Demonstrationszwecken montiert.
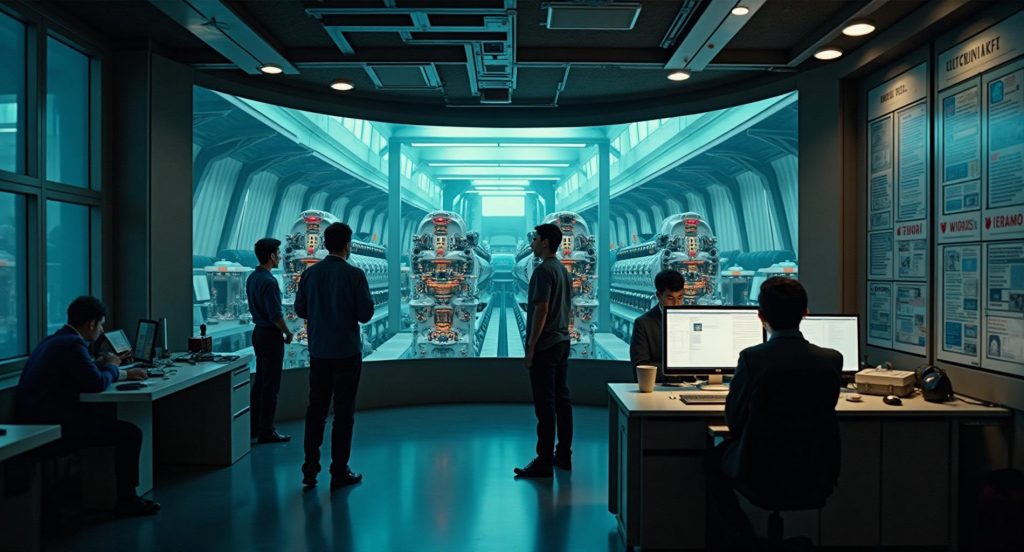
Die Verzahnung mit der Universität ist in den Schichtplänen sichtbar. Montags und donnerstags laufen Schülerlabore durch Kranblick 3, mittwochs sind die Berufsschule Nord und die Theaterpädagogik da: Erstere für Steuerungstechnik, letztere, um Hebezeuge für Bühnen umzurüsten. Auf dem Prüfstand stehen dann statt Hakentraversen Rahmen mit verdeckten Aufnahmen für Kulissen. Studierende der Limnologie bringen Sensorbojen vorbei, wenn es klemmt; der Elektroniker am Empfang steckt die Boje an den Diagnoserechner und ruft zurück, sobald der Spannungswandler wieder im Kennfeld liegt. SMS vergibt jährlich sechs Stipendien an duale Studierende und bietet Werkverträge im Datenraum an, in dem reale Kranbewegungen als anonymisierte Punktwolken visualisiert werden – eine Arbeit, die still ist und doch sehr konkret, weil am Ende eine Kabine ruhiger schwenkt.

Die Geschichte der Firma hat Eigenheiten, die man im Betriebsrundgang erzählt. Über dem Werktor hängt ein Holzschild mit eingebranntem Datum und dem Namen der zwei Gründer, die sich im 19. Jahrhundert aus einer Seilerei und einer Schlosserei zusammentaten. Der Anlasserknopf eines Vorkriegsmotors, der lange als Türöffner diente, sitzt noch heute hinter dem Pförtner; drückt man ihn, klickt eine Lampe an, aber nichts bewegt sich – die Starterbatterie ist ausgebaut, der Knopf bleibt als Erinnerung. In einer Hallenstütze haben Generationen von Auszubildenden ihre Hakenrisse nachgezogen; wenn eine Jahrgangsgruppe ihre Gesellenprüfung besteht, zieht sie eine neue, kleine Silhouette unter die alte. Der älteste Werkmeister erzählt, dass in den 1970er-Jahren die Mittagssirene einmal steckenblieb und über eine Stunde heulte; seither hängt an derselben Stelle eine gelbe Glocke, die nur bei Betriebsfeiern erklingt – man hört sie am Hafen, wenn die Hafennacht beginnt und der erste Ausleger einen Lichtervorhang ausrollt.

Kundschaft und Einsatzorte sind vielfältig und doch wiederkehrend. In den Fluss- und Teichhäfen der Region laufen K-200-Mobilkräne für Stückgut, die Katamarane der Wasserbehörde nutzen die leisen E-Pods für nächtliche Fahrten, und zwei Fähren über den Teich fahren mit Hybridpaketen, die im Winter an der Mole geladen werden. Größere Oberwagen gehen auf Binnenschiffen über Kanäle Richtung Mare Internum; wenn Sondertransporte nachts die Alte Hafenmole passieren, sichern Mitarbeitende mit Lampen und Hütchen die Kurve. SMS betreibt ein Servicefenster rund um die Hafenzeiten: Wer morgens um fünf einen Kran stillstehen hat, erreicht nicht die Zentrale, sondern direkt die Werkzeugausgabe am Kai. Die mobilen Servicewagen tragen kleine Teilelager für gängige Ventile, Endschalter und Dichtungen; jedes Fahrzeug hat darüber hinaus eine Kiste mit gesammelten Kleinteilen, in der handgeschriebene Zettel kleben, welcher Hafen welche Schraubensicherung bevorzugt.
Die Geschäftsführung liegt weiterhin in Familienhand; an der Spitze steht heute Mara Schröder, die selbst in Seestadt studiert hat und die Umstellung vieler Produktlinien auf modulare Hybridkonzepte vorantrieb. Neben ihr arbeiten ein technischer Leiter aus dem Werk, eine Leiterin für Einkauf mit langer Erfahrung in der Region und ein Personaler, der die Ausbildungsjahrgänge aus den umliegenden Schulen rekrutiert. SMS bildet Industriemechanikerinnen, Mechatroniker, Zerspaner und Elektroniker aus; in den Lehrwerkstätten stehen uralte Schraubstöcke neben CNC-Tischen, und an den Wänden hängen die Prüfzeichnungen der letzten zehn Jahre, fein säuberlich gelocht und in Holzleisten geklemmt. Zum Jahreslauf gehören ein Bewerbertage-Sonnabend im Frühjahr, bei dem man auf dem Prüfstand den Lastwechsel sehen darf, und ein Familientag im Sommer, an dem die Kinder mit Kranhaken Holzfische aus einer Wanne angeln – wer trifft, bekommt einen Stempel mit einem kleinen Anker in den Pass.
In die Stadt hinein wirkt SMS über Projekte, die außerhalb der reinen Produktion liegen. Für das Naturtheater im Osten stellte die Firma die Pontonanker der schwimmenden Bühne und ein Handwindenpaar, das vor jeder Premiere kontrolliert wird. Beim Festival „Teichklänge“ spendiert die Firma die Beleuchtungsmasten entlang eines Abschnitts der Promenade und stellt zwei Elektroaggregate leise hinter die Kastanien. Während der „Langen Leitung“ im Juni zeigt das Daten-Team im Nordpark, wie aus Kranbewegungen Kurven werden; wer will, zeichnet mit einem Holzgriff auf einem Tisch eine Lastkurve nach, die anschließend als Ausdruck am Schwarzen Brett hängt. In der Nacht der Glocke baut eine kleine SMS-Gruppe am Ufer Mikrofonmasten auf, nicht um Legenden zu bestätigen, sondern um Nebengeräusche herauszufiltern; die Aufzeichnungen gehen anschließend als Übung an die Informatikstudierenden der Universität.
Wirtschaftlich bleibt SMS ein Betrieb mit greifbaren Dingen: Stahl, Wellen, Lager, Steuerkabel, Öl, harzgeruchige Kisten mit E-Maschinen, die sauber etikettiert auf die Montage warten. Der Export in die Nachbarländer bringt die Notwendigkeit mit sich, Ersatzteile vorzuhalten und die Dokumentation in mehreren Sprachen zu pflegen; dafür gibt es im Bürotrakt eine Übersetzerin mit einem Schrank voller Normen und ein kleines Team, das nur Zeichnungsstände verwaltet. Man sieht an vielen Ecken, dass die Firma aus dem Hafen heraus gewachsen ist und hier bleiben will: Werkpforten liegen zum Kai, das Pförtnerhäuschen kennt die Gesichter der Fischauktionäre, und wenn im Winter der Nebel über den Teich zieht, laufen die Prüfstände etwas später an, weil die Luft dichter ist und die Lastkurve sonst nicht passt. In dieser Mischung aus Routine, Improvisation und dem festen Griff nach dem Kranhaken liegt der Alltag von Schröder Marine Systems – einem Betrieb, der Seestadt seit Generationen Werkssirenen, Lehrstellen, Motoren und Kräne liefert und jeden Morgen die großen Hallentore zum Wasser hin öffnet.

